
Genealogie Härting


Pegau um 1625
Härting
Namenkunde
E
in
sehr
interessantes
Gebiet
im
Rahmen
der
Familiengeschichtsforschung
ist
die
Namenkunde
(Onomastik).
Mit
ihrer
Hilfe
ist
es
möglich,
auch
über
die
heutigen
allgemeinen
familiengeschichtlichen
Quellen
hinaus,
Rückschlüsse
auf
das
Verbreitungsgebiet
1
und damit auf die Herkunft eines Namensträgers zu schließen.
In
Deutschland
wurde
der
Familienname
(FN)
erst
seit
dem
12.
Jahrhundert
allmählich
gebräuchlich.
Bis
dahin
waren
nur
Rufnamen
bzw.
Vollnamen
wie
z.
B.
Hardus
,
Harto
usw.
verbreitet,
die
damals
bei
der
geringen
Bevölkerungsdichte
als
Unterscheidungsmerkmal
ausreichten.
Gebildet
wurden
die
FN
überwiegend
aus
Personen-,
Tier-,
Pflanzen-,
Haus-,
Hof-,
Flur-,
Orts-
und
Berufsnamen.
Am
weitesten
zurück
führen
die
Orte
mit
dem
Suffix
-ing,
die
in
der
Regel
aus
Personennamen
(
Patronymikum
) entstanden sind.
Eine
große
Bedeutung
bei
der
Bildung
der
FN
hatte
die
mittelalterliche
deutsche
Ostbesiedelung
im
8.
bis
14.
Jahrhundert
und
auch
die
Entfaltung
der
Städte,
die
mit
einer
starken
Binnenwanderung
verbunden
waren
und
dadurch
die
Namens-
bildung
besonders
nach
Berufen
und
Herkunftsorten,
wie
z.
B.
Pertholt
de
Hartingen
(Berthold
von
Harting),
begünstigte.
Ha(ä)rting ist ein kleiner Ort in Bayern, drei Kilometer südöstlich von Regensburg entfernt.
1
Verein für Computergenealogie e. V., Dortmund.
2
Censualen (Zensualen) sind unfreie leibeigene Personen, die zinspflichtig waren. Nach dem Zensualrecht hatten die Personen einen Zins
(Abgaben, Pachtzins) an den Grundherrn zu zahlen.
3
Vgl. O. Dobenecker, 4. Band (1267 - 1288) und P. Böhme, Urkundenbuch des Klosters Pforte (1351 - 1500).
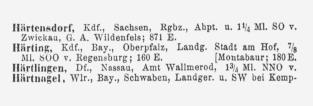
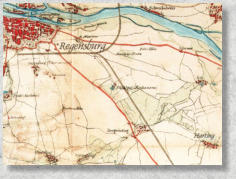
Leider
unterlag
der
FN
jahrhundertlang
einem
ständigen
Namenswechsel.
So
wurde
der
FN
unter
anderem
in
Deutschland
auch
häufig
mit
dem
Besitz
oder
dem
Wohnhaus
gewechselt.
Erst
seit
dem
17.
Jahrhundert
wurde
der
Namenswechsel
unterbunden
und
der
FN
allmählich
festgeschrieben.
Ein
weiteres
Problem
gab
es
bei
der
Namensänderung
durch
die
unterschiedliche
Schreibweise,
die
leider
bis
weit
in
das
19.
Jahrhundert
zulässig
war.
Die
Eintragung
der
FN
in
Urkunden
und
Registern
erfolgte
fast
nie
nach
Einsicht
urkundlicher
Unterlagen,
sondern
nach
mündlicher
Angabe,
so
wie
es
der
Schreiber
verstand.
In
einem
Erbkaufvertrag
über
drei
Acker
Feld
vom
11.
März
1659
kommt
der
FN
Härting
in
drei
Vari-
ationen
vor.
Im
Text
des
Amtsschreibers
von
Pegau
wird
der
Käufer
einmal
als
Glorius
Härting
und
an
anderer
Stelle
als
Glorio Härtingen
geschrieben, während er selbst mit eigener Hand als
Glorius Herttingk
unterzeichnet.
Mit Hilfe der Namensforschung habe ich nun versucht, über die allgemeinen familiengeschichtlichen Quellen hinaus, die
geschichtliche Entwicklung des FN Härting und somit die vermutliche Herkunft meiner Vorfahren zu ermitteln.

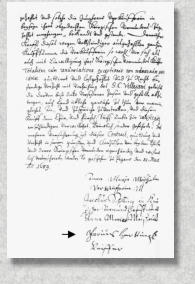
Der Ort Harting 3 km süd-östlich
von Regensburg entfernt
(Kartenausschnitt von 1858)
Ausschnitt aus dem Orts-Lexikon
von Deutschland 1868 mit dem
Ortsnamen Härting
Erbkaufvertrag vom 11. März 1659, in dem der gleiche Name
in drei verschiedenen Schreibweisen wie:
Glorius Härting, Glorio Härtingen, Glorius Herttingk
vorgefunden wurde
Die
aus
Hart/Hard
,
got.
H
ardus
gebildeten
Personennamen
finden
wir
im
westfränkischen
Raum
bereits
im
6.
Jahrhundert
unter
den
häufigen
Namen
Leod
ard
us
,
Med
ard
us
,
Got
hard
us
usw.
bis
in
das
12.
Jahrhundert
wieder.
Der
gotische
Stamm-
name
Hardus
soll
sogar
schon
im
3.
Jahrhundert
als
Eigen-
name
nachweisbar
sein.
Aus
den
althochdeutschen
Vollnamen
Ardo/Harto
bildeten
sich
allmählich
die
neuhochdeutschen
FN
wie z.B.:
.
> Hartes-Harden-Herdh(e)-Heerdt-Hört(h)
mit den patronymischen Ableitungen:
> Hart(d)ung-Harti(n)g-Herding-Herti(n)g-Härtig
und den mundartlichen Verformungen:
> Harding-Hartingk-Hert(t)ingk-Haerting-Härdtingk-
Härttingk-
Härting
.
ßend
aus
dem
germanischen
Raum
Bojohaemum
(Böhmen)
in
Raetia
(Bayern)
niederließen,
zurückzuführen
sind.
Durch
neuere
Erkenntnisse
in
der
archäologischen
Forschung
waren
es
markomannische
Südwestböhmen,
die
sich
vor
allem
in
den
Flussräumen
nördlich
der
Donau
um
Regensburg,
also
auch
in
dem
Gebiet
des
heutigen
Ortes
Harting
ansiedelten.
In
der
Mitte
des
6.
Jahrhunderts
verschwandt
der
Begriff
Raetien
,
der
seit
dem
1.
Jahrhundert
römische
Provinz
war,
und
durch
Baiuvari
, Männer aus dem Land
Baia
(Böhmen) ersetzt wurde.
Bei
uns
in
Deutschland
kommen
also
die
auf
-ing
endenden
Sippennamen
besonders
auffallend
in
Schwaben
und
Bayern
vor.
Hier
tritt
das
Suffix
-ing
in
förmlichen
-ing
-Haufen
und
noch
mehr
in
-ing
-Linien
angeordnet,
so
am
Rande
der
großen
Flusstäler, überhaupt mit Vorliebe im flachen und fruchtbaren Lande auf.
Einige -ing-Orte, -ing-Linien und -ing-Haufen in der Münchener Umgebung
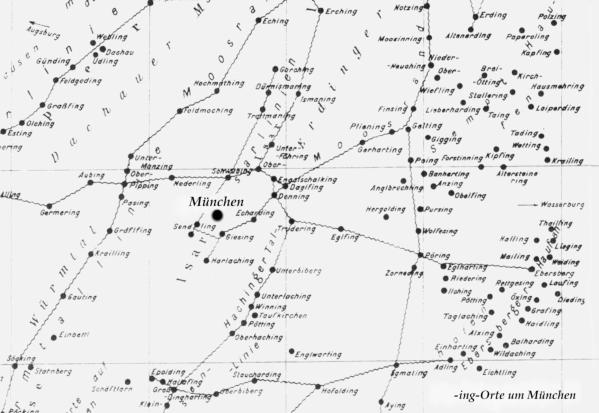
Der
Ort
Harting
bei
Regensburg
wurde
urkundlich
schon
863/864
erwähnt,
als
der
Edle
Arnedo
sein
Eigen
zu
Hartinga
(Siedlung bei Regensburg) gegen ein Lehen zu
Tann
(Siedlung bei Regensburg) verkaufte.
Unter
Heinrich
I.,
der
als
König
919
die
fünf
Stammesherzogtümer
Sachsen,
Thüringen,
Franken,
Schwaben,
Bayern
und
925
Lothringen
vereinigte,
wurde
die
Wiedergewinnung
des
deutschen
Ostens,
das
bis
zu
Beginn
der
Völkerwanderung
375
n.Chr.
bereits
durch
germanische
Stämme
wie:
Langobarden,
Semonen,
Sueben
(Schwaben),
Markomannen
(Bajuwaren),
Vandalen
usw.
besiedelt
war,
eingeleitet.
Heinrich
I.
schirmte
ebenfalls
das
Land
im
Osten
gegen
die
Einfälle
der
West-
Slawen
(Sorben
und
Wenden)
und
Magyaren
(Ungarn)
ab
und
errichtete
nicht
nur
Grenzmarken,
sondern
befestigte
seine
Grenzen
durch
Reichsburgen
wie
z.
B.
Groitzsch
(
Wiprechtsburg)
,
Leipzig
(
Pleißenburg
)
,
Altenburg
usw.,
in
deren
Schutzbereich
neue
Städte
gegründet
wurden.
Unter
ihm
entstand
auch
in
dem
durch
Slawen
besiedelten
Gebiet
die
Marken
Zeitz, Merseburg und Meißen, das spätere Sachsen.
Die
bereits
schon
im
8.
Jahrhundert
allmählich
beginnende
fränkisch-deutsche,
bäuerliche
Besiedelung
des
Ostens
wurde
nun
unter
Herzog
Lothar
von
Sachsen,
Graf
Wiprecht
II.
von
Groitzsch
,
Herzog
Heinrich
dem
Löwen
von
Sachsen
und
durch
die Missionsarbeit der Klöster verstärkt vorgenommen.
In
den
Anales
Pegavienses
zum
Jahre
1104
wird
berichtet,
dass
Graf
Wiprecht
II.
von
Groitzsch
die
ausgedehnten
Waldgebiete
zwischen
den
Flüssen
Schnauder,
Wyhra
und
Mulde
mit
fränkischen
Kolonisten
besetzte,
die
er
selbst
in
großer
Anzahl
aus
der
Gegend
um
Regensburg
herbeiholte.
Auch
das
Kloster
St.
Emmeram
in
Regensburg
war
schon
Ende
des
8. Jahrhunderts ein Zentrum für Missionsarbeit in dem Slawengebiet zwischen Saale und Elster.
Etwa
zu
dieser
Zeit
finden
wir
in
den
Urkunden
des
Hochstifts
Regensburg
und
des
Klosters
St.
Emmeram
den
Nachweis
von
einigen Ha(e)rting-Namensträgern, die in dem bayrischen Ort Ha(ä)rting bei Regensburg etwa 125 Jahre ansässig waren, wie
z. B.:
> Berthold von Harting und Otto von Harting (1095 - 1120).
Familiengeschichtsforschung in Kursachsen
Offensichtlich
handelt
es
sich
hierbei
um
Personen
einer
Sippe,
die
zu
dieser
Zeit
in
der
Siedlung/Kolonie
Harting
ansässig
waren
und
deren
gemeinsamer
früher
Vorfahre,
als
erster
Besitzer
und
Gründer
im
8.
Jahrhundert,
dieser
alten
bajuwa-
rischen
Siedlung
auch
den
Ortsnamen
Harting
gegeben
haben
könnte.
Der
Kolonatsname
Harting,
vom
ersten
Besitzer
entlehnt,
blieb
an
den
Grundstücken
haften
und
ging
dann
auf
dessen
Nachfolger
über.
Andererseits
könnte
es
bei
den
oben
aufgeführten
Rufnahmen
Berthold,
Otto,
Bruno,
Heinrich
und
Hermann
Ulli,
auch
um
später
zugezogene
Personen
handeln,
die
zur
Unterscheidung
als
Beinamen
den
Herkunftsort
Harting
als
auffälliges
Merkmal
in
den
Urkunden
erhalten
haben.
Da
immer
mehr
Personen
den
gleichen
Rufnamen
trugen,
war
eine
unmissverständliche
Identifizierung
des
Einzelnen
nicht
mehr
gewährleistet.
Nach
dem
Sturz
Heinrich
des
Löwen
im
Jahre
1180
brach
plötzlich
das
mächtige
sächsische
Herzogtum
zusammen,
welches
sich
nun
auf
die
Besitztümer
des
Grafen
Bernhard
von
Askanien,
ein
Sohn
des
Sachsenherzogs
Albrecht
des
Bären,
beschränkte.
Er
vereinigte
sein
Erbland
an
der
oberen
Elbe
um
Wittenberg
mit
Lauenburg
unter
den
Namen
eines
Herzogtums
Sachsen.
Nach
dem
Aussterben
des
Geschlechts
der
Askanier
im
Jahre
1422,
erhielt
Markgraf
Friedrich
I.
der
Streitbare
von
Meißen
als
königlicher
Lehnsträger
das
Land
und
die
Kurwürde.
Der
Landesname
“Sachsen”
wanderte
damit
elbaufwärts
und
wurde
allmählich
auch
für
die
Marken
Merseburg,
Zeitz
und
Meißen
gebräuchlich.
Der
politische
Begriff
Sachsen
ist
im
Stammland
der
alten
Sachsen
von
Nordwestdeutschland
nach
Mitteldeutschland
verschoben
worden,
während die Altsachsen als Volk in Norddeutschland, heute Niedersachsen, verblieben.
Aus
den
Erkanntnissen
der
Namenkunde
und
der
geschichtlichen
Entwicklung
des
mitteldeutschen
Sachsens
können
wir
annehmen,
dass
die
Härtingschen
Vorfahren
während
der
großen
deutschen
Ostbesiedelung,
etwa
in
den
Anfängen
des
13./14.
Jahrhunderts
als
schwäbisch-bayrische
Kolonialbauern,
vermutlich
aus
dem
Ort
Ha(ä)rting,
nach
Sorben
in
die
Marken Zeitz und Merseburg, dem heutigen Sachsen, übergesiedelt waren.
Einige
Urkunden
aus
dem
13./14.
Jahrhundert
deuten
darauf
hin,
dass
unsere
Vorfahren
möglicherweise
von
Nordbayern
über
Thüringen
in
die
Marken
Zeitz
und
Merseburg
übergesiedelt
sein
könnten.
Denn
am
23.
Juli
1280
trat
erstmalig
bei
einem
Grundstückskauf
ein
Hartung
von
Sachsenhausen
b.
Weimar
in
Thüringen
als
Zeuge
auf.
Ferner
verkaufte
am
4.
Februar
1425
ein
Hans
Hertnick
(wohl
Hertinck)
zu
Buttelstedt
b.
Weimar
alle
seine
Güter
in
Sachsenhausen,
Leutenthal
und
Obringen
für
200
Rheinische
Gulden
an
Ludolf
von
Arnstdt
in
Zoppothen
b.
Saalburg.
Diese
Hertinckschen
Güter
wurden
schließlich
am
9.
März
1427
durch
Friedrich
I.,
Landgraf
in
Thüringen,
Markgraf
zu
Meißen
und
Pfalzgraf
zu
Sachsen
dem
Kloster
Pforte
b.
Naumburg,
zugeeignet.
3
Möglicherweise
ist
die
Familie
Hans
Hertinck
nach
dem
Verkauf
ihrer
Güter
von
Thüringen
nach
Sachsen
in
Richtung
Naumburg,
Zeitz
und
Pegau
übergesiedelt.
Denn
auch
in
Naumburg
und
Zeitz
haben
sich
Ha(e)rting-Namensträger
laut
den
Türken-
und
Landsteuerregistern
etwa
Mitte
des
16.
Jahrhunderts
niedergelassen,
wie
z. B.:
>
Mattes
Hartting
,
1551
in
Naumburg,
Langemergengasse
,
mit
einem
Vermögenswert
von
135
n.ßo,
zahlt
5
fl.
16
gr.
10
Pf.
…..
Landsteuer und 1 fl. 9 gr. 5 Pf. Türkensteuer.
>
Bartel
Herting
,
1568
in
Zeitz,
in
den
Vorstetten
vor
dem
Wasserthor
,
mit
einem
Vermögenswert
von
5
n.ßo,
zahlt
3
gr.
9
d.
…..
Landsteuer für Haus und Hof.
Am 31.10.1095 treten
Perhtolt de Hartingen
mit seinem Vater
Otto
nebst weiteren 16 Personen als Zeugen in Regensburg
auf,
als
Abt
Pabo
mit
der
Dienerin
Machthild
des
Klosters
St.
Emmeram,
Besitzungen
zu
Isling
(Siedlung
bei
Regensburg)
tauscht.
Ferner
treten
im
Jahre
1105
Perhtoldus
de
Hartingen
nebst
weiteren
sechs
Personen
als
Zeugen
in
Regensburg
auf, als
Enziman
einen Leibeigenen als Censualen
2
übergibt.
> Bruno von Herting und Heinrich von Herting (1135 -1160).
Im
Jahre
1155
treten
Bruno
und
Vater
Henricus
de
Hertingen
nebst
weiteren
16
Personen
als
Zeugen
in
Regensburg
auf,
als
der
Bistumsministerial
Haward
vom
Abt
Adalbert
im
Tausch
gegen
Besitz
zu
Harting
ein
Hof
zu
Gämelkofen
(Siedlung
bei
Regensburg),
ferner
als
Lehen
ein
Hof
zu
Helmprechting
(Siedlung
bei
Regensburg)
und
einen
Weingarten
bei
Schwabelweis (Siedlung bei Regensburg) erhält.
> Hermann Ulli von Herting (1219).
Im
Jahre
1219
tritt
Hermannus
uillicus
de
Hertinge
nebst
weiteren
14
Personen
als
Zeugen
auf,
als
Irnfrid
von
Dünzling
(Siedlung bei Regensburg) seine Frau und seine Kinder als Censualen übergibt
.
Bei
den
auf
-ing
endenden
Familienamen
handelt
es
sich
zweifellos
um
die
ältesten
deutschen
Sippennamen,
die
auf
die
ältesten deutschen Siedlungen der
Bajuwaren
(Markomannen),
die sich während der Völkerwanderung über die Donau vorsto-






Der Ort Härting bei Regensburg
(Bayernkarte von Philip Apian 1568)













